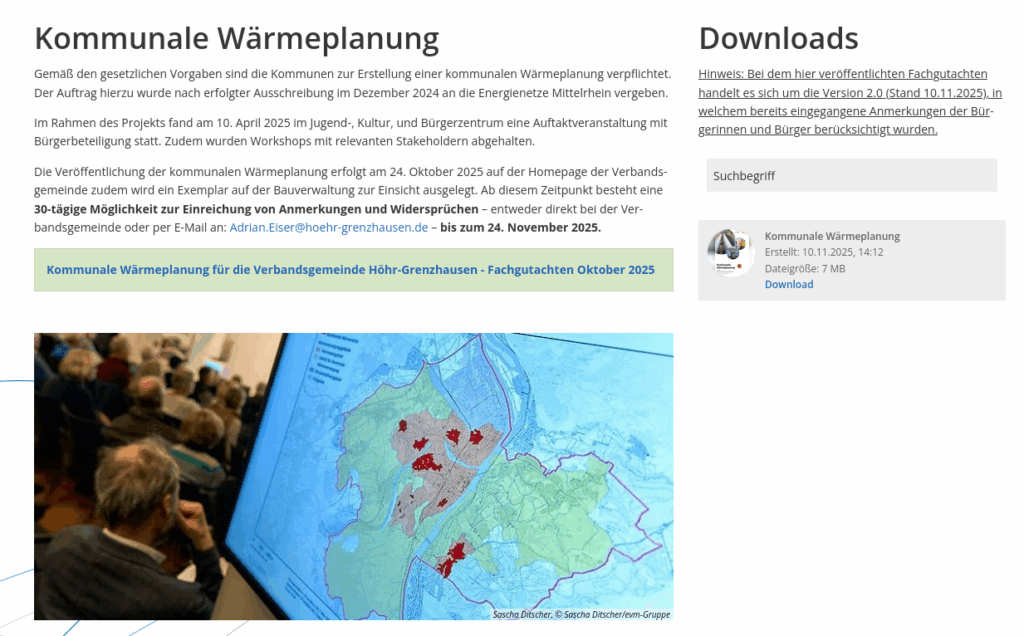
Am 24. Oktober 2025 legte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) AG das gemeinsam mit der Firma endura Kommunal GmbH erstellte Fachgutachten zur Kommunalen Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen vor.
Bis zum 24. November 2025 haben die Bürger und Bürgerinnen Zeit, Anmerkungen und Widersprüche einzureichen.
Quelle und Download: Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen
Zusammenfassung des Fachgutachtens zur Wärmeplanung Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen
Ausgangssituation (Bestandsanalyse 2024)
- Endenergiebedarf Wärme: 223 GWh/Jahr
- Fossile Abhängigkeit: 95% der Wärmeversorgung basiert auf fossilen Energieträgern (88% Erdgas, 5% Heizöl)
- Sanierungsbedarf: 80% der Gebäude wurden vor 1979 gebaut, 41% der Heizungen sind über 20 Jahre alt
- Keine Wärmenetze vorhanden
Potenziale
- Sehr gut:
- Solarthermie-Dachanlagen und PV-Dachanlagen
- Oberflächennahe Geothermie (Erdwärmesonden)
- Umgebungsluft (unbegrenzt für Wärmepumpen)
- Gut:
- Windenergie (5 mögliche Anlagen, ca. 75 GWh/Jahr)
- PV-Freiflächen und Parkplatz-PV
- Nähe zum Wasserstoff-Kernnetz für industrielle Nutzung
- Begrenzt:
- Biomasse aus Kommunalwald
- Abwärme aus Kläranlagen (gering)
Zentrale Empfehlungen
- 2 Wärmenetzgebiete identifiziert: Höhr Kernort und Grenzhausen Altstadt, allerdings ist deren Wirtschaftlichkeit derzeit fraglich
- Erdsondenfelder und Solarthermie als Wärmequellen prüfen
Maßnahmen für das Zielszenario 2045
- Energieeinsparung:
- 27% Reduktion des Wärmebedarfs auf 161 GWh/Jahr
- 88 Wohngebäude pro Jahr sanieren (2% Sanierungsrate)
- 1 öffentliches Gebäude pro Jahr (ca. 850 m²)
- Umstellung auf Erneuerbare:
- 247 Gebäude pro Jahr auf Wärmepumpen umrüsten
- 34 Wärmenetz-Hausanschlüsse pro Jahr (0,5 km Hauptleitung, 0,8 MW Erzeugung)
- 102 Erdsondenbohrungen pro Jahr
- Stromerzeugung für Wärme:
- Bedarf: 55 GWh/Jahr Strom
- Deckung durch z.B. 3,6 Windkraftanlagen oder 61 ha PV-Freiflächenanlagen
Priorisierte Maßnahmen
- Umsetzung der kommunalen Sanierungsstrategie: Fokus auf öffentliche Gebäude als Vorbild
- „Energieberatung light“ intensivieren: Ausbau der bereits bestehenden Erstberatung für Bürger
- Einführung kommunales Energiemanagement: Systematisches Monitoring aller kommunalen Liegenschaften
- Rechtliche Rahmenbedingungen für kommunalen PV-Ausbau schaffen: Klärung der Organisationsstruktur zur Vermeidung energiewirtschaftlicher Verpflichtungen
- Strategie Ausbau Windenergie entwickeln: Kommunales Flächenpooling und Windenergiekonzept
- Wasserstoffstrategie Gewerbegebiet Nord-Ost Grenzhausen: Dialog mit energieintensiven Unternehmen und Netzbetreiber
Unsere Kritikpunkte am Fachgutachten
Die gesamte Planung ist ein Phantasieprodukt, das in dieser Form niemals umgesetzt werden wird. Es ist nichts anderes als eine Idee, wie man das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis 2045 theoretisch und rechnerisch erreichen könnte. Die Umsetzbarkeit in der Realität wird dabei nicht betrachtet, sprich,
- ob die Kosten für den Bau der Infrastruktur oder die erforderlichen Sanierungen überhaupt getragen werden können,
- ob man Genehmigungen für Bohrungen oder Windmaschinen bekäme,
- ob man nicht große Umweltprobleme durch Bohrungen, Fundamente etc erzeugen würde,
- ob die Windkapazität oder Sonnenscheindauer überhaupt zur Versorgung ausreichen würde
- etc.
Beim Lesen des Gutachtens sollte dies jedem bewußt sein. Den Planern ist dies bewußt, in der Bürger Informationsveranstaltung wurde darauf auch explizit hingewiesen
Wir möchten an dieser Stelle einfach einige Widersprüche und allzu optimistischen Rechnungen transparent machen.
1.) Fehlende Wirtschaftlichkeitsanalyse und Betrachtung der Umweltfreundlichkeit
Definitionsgemäß soll dieses Gutachten die Ziele Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung miteinander vereinen. Im späteren Verlauf wird jedoch „Umweltfreundlichkeit“ offensichtlich mit „Klimafreundlichkeit“ gleichgesetzt, was fachlich grundsätzlich falsch ist:
- Klimafreundlich = Auswirkungen auf das Klimasystem, bezieht sich speziell auf den CO₂-Ausstoß und andere Treibhausgase wie bspw. Methan. Elektroautos haben zwar keine direkten CO2 Emissionen, für die Batterieproduktion wird dennoch erheblicher ökologischer Schaden angerichtet. Windkraftanlagen sind wg des Flächenverbrauchs und Vogelschlags etc. ebenfalls ein ökologisches Desaster.
- Umweltfreundlich = Auswirkungen auf das gesamte ökologische System. Luftqualität, Wasserverschmutzung, Artenvielfalt, Flächenverbrauch, Lärmbelastung, Ressourcenverbrauch, Abfallproduktion. Ein recyclebares Produkt kann bspw. umweltfreundlich sein, aber dennoch bei der Herstellung einen Hohen CO2 Ausstoß verursachen.
Eine Betrachtung der Umweltfreundlichkeit bzw ökologischen Verträglichkeit der identifizierten Potentiale bspw. der Windenergienutzung fehlt vollständig.
Ebenso ist die Wirtschaftlichkeit als Ziel dieses Gutachtens definiert, der Begriff taucht über 45 Mal im Dokument auf. Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der einzelen Potentiale sowie der Wärmenetze(Fokusgebiete) gibt es allerdings erhebliche Schwachpunkte:
- Investitionskosten von 17,6 Mio. € (Höhr) bzw. 9,8 Mio. € (Grenzhausen) werden genannt, Jahreskosten von 2,7 Mio. € bzw. 1 Mio. € – Aber: keine Wärmegestehungskosten pro kWh, keine Amortisationsrechnung oder ein Wirtschaftlichkeitsvergleich mit dezentraler Versorgung, das Risiko der Förderzusage wird nicht erwähnt, die Sensitivitätsanalyse bei variierenden Anschlussquoten oder Energiepreisen fehlt ebenso vollständig. Das Gutachten räumt selbst ein: „Die Entwicklung klassischer Wärmenetze ist in der Verbandsgemeinde zu den aktuellen Rahmenbedingungen vermutlich nicht wirtschaftlich“ (S. 12), definiert diese aber trotzdem als Wärmenetzgebiete – ohne belastbare Wirtschaftlichkeitsnachweise.
- Die Wirtschaftlichkeit der Planung für die Bürger wird in keiner Weise betrachtet: Die Kosten für eine energetische Sanierung eines typischen Einfamilienhaus (150m²) liegen optimistisch geschätzt bei mindestens 64 000 – 150 000€ für Fassaden-, Dach und Kellerdämmung, Fenstertausch, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörpertausch. Weitere Renovierungskosten, die sich daraus ergeben, wurden nicht berückksichtigt. Die Teuerungsrate im Bau ebenfalls nicht. Auch mit Förderung bleiben erhebliche Eigenanteile. Steigende Zinsen machen Kredite zudem teuer, wenn man überhaupt einen erhält (Alter, Selbstständigkeit etc). Weiteres dazu unter „Sozioökonomische Aspekte“
2. ) Unrealistische Umsetzbarkeit
Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftskrise in Deutschland sowie der anhaltenden Inflation, erscheinen die Annahmen in der Planung absolut utopisch:
- Eine Sanierungsrate von 2% wird zugrunde gelegt. Aktuell haben wir deutschlandweit eine Sanierungsrate von 0.69%, in den Jahren 2024 waren das 0.70%, 2023 0.88%. Eine Sanierungsrate von 2% wären 88 Gebäude pro Jahr, wovon eine optimistische Einsparung von 49% für Bestandsgebäude erwartet wird. Keine Differenzierung zwischen Vollsanierung und Einzelmaßnahmen, die Kosten für die Sanierungen werden weder für die Bürger noch die Kommune quantifiziert. Bei 80% Gebäuden vor 1979 und hohem Denkmalschutzanteil in den Altstädten ist die Zielerreichung höchst fraglich.
- Zeitlich muß für eine energetische Sanierung mit Maßnahmen wie Dämmung, Fenstertausch oder Heizungserneuerung mindestens 4-8 Wochen veranschlagt werden. Eine Kernsanierung kann zwischen 3 Monaten und 1 Jahr dauern, abhängig vom Umfang. Eine komplette Haussanierung zwischen 6 und 12 Monaten. In Höhr-Grenzhausen gibt es nur wenige Handwerksbetriebe, die solche Sanierunsgarbeiten durchführen. Die Zielsetzung von 88 Häusern pro Jahr erscheint vor diesem Hintergrund unrealistisch.
- Die realistische Jahreskapazität beim Einbau von Wärmepumpen liegt derzeit in Deutschland bei 200 000 – 350 000 Wärmepumpen. 2024 wurden nur rund 193 000, im Rekordjahr 2023 rund 356 0000 installiert. Die Wärmeplanung sieht im Szenario 2045 vor, dass 247 Gebäude (=Wärmepumpen) pro Jahr installiert werden sollen. Aktueller Statistik kann man entnehmen, dass ca 14 000 Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker zur Umsetzung der „Energiewende“ fehlen, nur 15% der aktuellen SHK- Handwerker sind in der Lage, eine Wärmepumpe fachgerecht zu installieren. Bis 2030 werden 30 000 Fachkräfte in diesem Bereich alters- oder krankheitsbedingt ausscheiden. Braucht ein Handwerker zum Austausch einer Gas-Brennwertheizung ca 1 Tag, werden für eine Wärmepumpe normalerweise 12-17 Manntage veranschlagt. Rechnerisch könnte man womöglich optimiert noch auf 2-3 Wärmepumpen im Monat kommen – mit 36 Wärmepumpen pro Handwerker/Jahr erscheinen die geforderten 247/Jahr vollkommen unrealistisch. Das Handwerk kann nicht mal ansatzweise die politisch geforderten Zahlen stemmen. Es bräuchte 60.000 zusätzliche Installateure, um bis 2030 6 Millionen Wärmepumpen einbauen zu können.
- Unsicherheiten wie bspw. Lieferengpässe bei Komponenten (primär aus China) wie Elektronik (z.B. Steuerplatinen, Sensorik), Kältemittelkomponenten (z.B. Ventile, Wärmetauscher), Zollstreitereien oder Streit um die EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung sind in den optimistischen Rechnungen der Wärmeplanung gar nicht berücksichtigt.
3.) Fragliche Fördergelder
Zwar rechnet die Kommunale Wärmeplanung fest mit Fördergeldern aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), die Risiken und deren unsicher Finanzierung wird aber verschwiegen:
- Insgesamt sollen rund 3 Milliarden Euro bis 2026 für die BEW zur Verfügung gestellt werden. Vergabe nach dem Windhundprinzip, wieviel für Folgejahre vorhanden ist, weiß keiner.
- Die veranschlagten rund 400 Millionen Euro pro Jahr gehen von einem deutlich zu niedrigen Investitionsbedarf aus. Benötigt wird eine Bundesförderung von mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr bis 2035 (Kritik VKU).
- Die BEW wird direkt aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert, dessen Säulen wackeln.
- Einnahmen aus CO₂-Bepreisung (BEHG): Nich zuverlässig berechenbar, ab 2027 nicht mehr national. Unklar wieviele Einnahmen Deutschland zufließen oder auf EU-Ebene verbleiben.
- Erlöse aus dem EU-Emissionshandel (EU-ETS), ab 2027 EU-ETS2 auf EU-Ebene. Siehe oben.
- Bundeszuweisungen aus dem Haushalt gab es 2025 keine (2024 ca 10 Milliarden), stattdessen sollten aus dem als „Sondervermögen“ bezeichneten großen Schuldenprogramm (insgesamt 500 Mio für Infrastruktur und Rüstung) insgesamt 100 Milliarden Euro in den KTF fließen. Jährlich 10 Milliarden (Entscheidung 2.10.2025 rückwirkend für 2025). Also die 10 Millionen, die in 2024 noch aus den Steuereinnahmen des Haushalts zur Verfügung standen, werden nun Schulden-finanziert ersetzt. Im Nov 2023 hatte das Bundesverfassungsgericht die Verschiebung der ursprünglich für die Coronapolitik eingeplanten Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro als verfassungswidrig eingeschätzt, so dass der KTF 2024 stark abgeschmolzen war.
Die von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie „Neue Wege für die Energiewende (Plan B)“ zeigt dass die bisher verfolgte Stratgie in eine volkswirtschaftliche Sackgasse führt. Von 2025-2049 rechnet man mit Kosten von 4,8 – 5,5 Billionen Euro. Ohne starke Wirtschaft ist dich absolut utopisch. Im Jahr 2025 geben 59% der Industriebetriebe mit >500 Mitarbeitern an, die Produktion einschränken zu wollen oder abwandern zu wollen. Dies sind über 20% mehr als noch im Jahr 2022. Für Kommunen und Wärmenetzbetreiber bedeutet dies eine große Planungsunsicherheit.
4.) Sozioökonomische Aspekte
Die Kommunale Wärmeplanung rät zwar der Gemeinde zu einer umfassenden Beratungs- und Kommunikationsstrategie, betrachtet die sozioökonomischen Aspekte der Bürger jedoch nicht. Die Kommunikationstrategie beruht alleine darauf, dass man dem Bürger die Notwendigkeit zur Abschaltung der über Jahrzehnte für Milliardensummen zuverlässigen Gasversorgungsnetze nur ausreichend und ausreichend oft erklären müsse. Dass die wirtschaftliche Basis bei den Bürgern für Sanierungskosten in der erwarteten Größenordnung nicht vorhanden sein könnten und nicht reines Unverständnis sondern die knallharte wirtschaftliche Realität zur Ablehnung der Massnahmen führen könnte, bleibt unerwähnt.
Die Analyse der folgenden Aspekte fehlt vollständig:
- Kostenschätzung für Bürger: Was kostet die Umstellung auf Wärmepumpe/Wärmenetz pro Haushalt?
- Einkommensdaten: Hohe Sanierungskosten in Gemeinden mit 80% Altbauten – soziale Verträglichkeit?
- Mieterbetrachtung: Wie wirkt sich die Wärmewende auf Mietkosten aus?
- Altersstruktur nicht berücksichtigt: Ältere Eigentümer investieren seltener in Sanierung , erhalten zudem keine Kredite mehr.
- Gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands: Seit Juli 2024 haben Unternehmen in Deutschland den Abbau von über 140.000 Arbeitsplätzen angekündigt. In einer aktuellen Umfrage gaben 35 Prozent der Unternehmen an, einen Beschäftigungsabbau zu planen. In der Industrie planen 44 Prozent der Unternehmen Stellenabbau, während nur 14 Prozent Neueinstellungen planen. Die Hauptgründe sind hohe Energiekosten, schwache Nachfrage (besonders bei E-Autos), chinesische Konkurrenz und die allgemeine Wirtschaftskrise in Deutschland.
- Schrumpfende Gewerbesteuereinnahmen durch Stellenabbau und Unternehmenskrisen, gleichzeitig steigende Sozialausgaben (mehr Arbeitslose, Bürgergeld) , Sanierungsstau bei Schulen, Infrastruktur bei Kommunen
5.) Kommunale Bindungswirkung – keine Möglichkeit zur demokratischen Ablehnung
Zur Umsetzung von Wärmeplänen können im besonderen Städtebaurecht Möglichkeiten genutzt werden, mit deren Hilfe Eigentümer zur Umsetzung wärmebezogener Maßnahmen verpflichtet werden können – insbesondere städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Stadtumbaumaßnahmen nach BauGB. Die Bindungswirkung der kommunalen Wärmepläne ist verwaltungsrechtlicher Natur. Nach Bestätigung durch den Gemeinderat ist der Wärmeplan bei der Bearbeitung von Bauleitplänen oder Vorhaben nach BauGB zu berücksichtigen. Der Gemeinderat – der die Interessen der Bürger der VG demokratisch repräsentiert – hat bei dieser Kommunalen Wärmeplanung keine Widerspruchsmöglichkeit. Es ist nur vorgesehen, dass die Planung bestätigt wird. Damit steht der Gemeinderat zwischen der Verwaltung und den Bürgern:
- Es besteht die Pflicht, finanziellen Schaden von der Gemeinde abzuwenden – auch dadurch, dass aufgrund des Förderantrags Fristen zu wahren sind, ansonsten wird die Förderung unwirksam und die Gemeinde muß die zwingend bis 2028 vorzulegende Planung selbst bezahlen.
- Andererseits hat der Gemeinderat die Pflicht, (finanziellen) Schaden durch unfinanzierbare Sanierungspflichten und Anschlußzwang vom Bürger fernzuhalten.
6.) Unausgegorene Technologie/nicht-vorhandene Infrastruktur
Die im Kommunalen Wärmeplan vorgesehenen Technologien sind teilweise unausgegoren oder technisch nicht umsetzbar, weil die Infrastruktur fehlt oder in Frage gestellt werden muß.
- Wasserstoff und Wasserstoff-Kernnetz: Die Bundesnetzagentur hat zwar den Antrag zum Bau des H2 Kernnetzes (9040 km insgesamt, 60% Umstellung bestehender Gasleitungen) im Oktober 2024 genehmigt. Jedoch ist bislang nicht viel davon zu sehen. Die ersten Leitungen sollten im April 2025 einspeisen, was offenbar nicht stattgefunden hat (bspw. GET H2 Nukleus). Zudem mangelt es an Nachfrage in der deutschen Industrie. Diese wandert lieber ab in Produktionsländer, wo die Energiekosten bezahlbar sind.
Der Umbau bestehender Gasleitungen zu Wasserstoffleitungen wird zwar als technisch machbar aber nicht trivial eingeschätzt. Risiken von Gasleckagen und resultierenden Explosionspotentialen sind nicht unerheblich und auch bei anderen Kostenkalkulation bei der Industrie (Feuerwehr etc) mit einzubeziehen. Viele H2 Projekte wurden in den vergangenen Jahren abgesagt:- Nov 2023, Heide/Westküste 100 – H2 Elektrolyseur
- Feb 2024, Hannover – Elektrolyseur
- März 2024, Bad Dürkheim – Elektrolyseur
- Sept 2024, Norwegen – H2 Pipeline Projekt gestoppt, Shell Projekt ebenfalls
- Mai 2025, Kaisersesch – Smart Quart
- Mai 2025, Emden – Statkraft beendet H2 Vorhaben
- Juni 2025, Boxberg und Leipzig – H2 Projekt und Wasserstoffzentrum
- Juli 2025, Bremen, Hamburg – Wasserstoffprojekt, Hamburger Hafen
- Sept 2025, Völklingen – Wasserstofffabrik
- Okt 2025, Wittenberg, Elektrolyseur
- (..)
- Geothermie: Potential bedeutet nicht Realisierbarkeit. Das Erdwärmepotential wird mit 45 – 266 GW/Jahr (1 – 20 Sonden je Flurstück, S. 54) angegeben und ist auch Bestandteil zur Erzeugung im Fokusgebiet. Die Kosten pro Sonde liegen bei einem Richtwert von 10 000 – 15 000 €, es wird eine Bohrtiefe von 99m angenommen. Diese kann aber auch wesentlich tiefer (bis 400 m) ausfallen müssen, wobei die Bohrung extrem kostenintensiv ist (vgl. aktuelle Grundwasserbohrung im Gemeindegebiet). Genehmigungsverfahren werden nicht thematisiert, die geologische Detailprüfung fehlt ebenfalls. dennoch hängen die empfohlenen Wärmenetze im Fokusgebiet maßgeblich von solchen Erdsondenfeldern ab. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch die Gefährdung der Grund- und Quellwasservorkommen, die durch Geothermie- Tiefenbohrungen ehrheblichen Schaden nehmen können. Bohrungen für Erdsondenfelder der angedachten Größenordnung sind vom Gefährungspotential eine andere Kategorie als für ein Einfamilienhaus. Hat man Grundwasser angebohrt, ist der resultierende Umweltschaden erheblich. Auch Altlasten im Boden können zu Bohrverboten führen.
7.) Lebensdauer der Industrieanlagen
Die Lebensdauer der unterschiedlichen Energiegewinnungsanlagen findet im Kommunalen Wärmeplan keine Berücksichtigung. Damit fehlt ein erheblicher Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsanalyse vollständig:
- Windenergieanlagen: Lebendauer von 20-25 Jahren bzw. wenn die Förderung ausläuft da unsubventioniert eben nicht wirtschaftlich. Insbesondere in Schwachwindgebieten wie Höhr-Grenzhausen. Versorgungslücke (und Finanzierungslücke?) bei Rückbau/Repoweringsphasen. Benötigte Backup Gaskraftwerke fehlen (rechnerisch 71 in Deutschland weder geplant, noch genehmigt oder im Bau, Finanzierungsfrage offen, Frage der Gasversorgung ebenfalls). Heute im Bau befindliche Projekte wie bspw. Windpark Haiderbachhöhe werden 2045 das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Dies ist in der Planung nicht berücksichtigt.
- PV-Anlagen: Lebensdauer von 25 bis 35 Jahren (polykristallin), evtl länger. Wechselrichter ca 15 Jahre.
- Batteriespeicher: Lebensdauer nur maximal ca 15-20 Jahre, bei 4000-5000 Ladezyklen. Zudem hohe Risiken für Großbrände.
- Wärmepumpen: Lebensdauer 20-25 Jahre. Die aktuell eingebauten Wärmepumpen werden bis zum Jahr 2045 erneuerungsbedürftig sein. Dies müßte in der Sanierungsquote einkalkuliert werden, denn der Ersatz einer Wärmepumpe benötigt ebenso Handwerkerleistung/-verfügbarkeit wie der Neueinbau. Die geringe Lebensdauer unterstreicht die Utopie der Sanierungsquote. Hinzu kommen sozioökonomische Aspekte, denn selbst wenn es derzeit für den Umstieg Förderungen gab/gibt – die Kosten für den Ersatz nach 20 Jahren müssen selbst getragen werden. Erste Ausfälle bei ca 10 Jahre alten Anlagen werden bereits jetzt gemeldet, was die Kosten für die Bürger in die Höhe treibt und die Akzeptanz schmälert.
8.) Fragliche Einschätzungen zu Strombedarf und Potenzialen
- Der Strombedarf für Wärmepumpen wird mit 55 GWh/Jahr 2045 eingeschätzt. Dieser soll durch 3,6 Windindustrieanlagen oder 61 ha PV-Freifläche gedeckt werden. Laut Planung wären 5 Windenergieanlagen möglich, allerdings sind die dafür veranschlagten Flächen bislang nicht zum Windvorrangebiet erklärt – die Planung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist nicht abgeschlossen, die Fortschreibung des RROP darf demnach nicht als gegeben angenommen werden. Hinzu kommt, dass diese Flächen in Wasserschutzgebieten sind (Konkurrenz und Ablehnung der Bevölkerung), eine Fläche zwar in der Gemarkung steht, aber nicht der Kommune gehört sondern der Nachbarkommune. Mit diesen Flächen zu planen ist höchst fragwürdig.
Im Flächennutzungsplan sind bislang gerade 19 ha Photovoltaik der veranschlagten 61 vorhanden. Weitere Flächen wurden bereits vom Gemeinderat abgelehnt. Die PV-Förderkulisse umfasst in nicht unwesentlichem Umfang bewaldetes Wandergebiet und den im Tal gelegenen Stadtteil Grenzau, der aufgrund seiner topologischen Lage bereits weniger Sonnenstunden aufweist als andere Gebiete. Der Meyerberg verfügt zwar über PV-Anlagen auf den Stallungen, aber da die Betreiber ihren Wirtschaftssitz in Alsbach haben, ist zu vermuten, dass der Anschluß in die Nachbargemeinde erfolgt. - Die identifizierten Abwärmepotentiale in der Planung sind marginal, dennoch wurde das Fokusgebiet darauf ausgerichtet. Das Abwasserwärmepotential der Kläranlagen Höhr wird mit 2,4 GWh/Jahr, die industrielle Abwärme mit 6,4 GWh/Jahr einbezogen. Letztere ist fraglich, da entweder kein Interesse zur Bereitstellung vorliegt, die Industriebetriebe keine technischer Umsetzbarkeit sehen oder gar nicht erst auf die Fragebögen reagiert haben, was als vollständige Ablehnung angesehen werden sollte. Eine Klassifizierung als „bedingt geeignet“ ist daher fraglich. Dennoch basiert das Fokusgebiet auf dem Abwärmepotential von 0,7 MW Leistung: 6,3 MW benötigte Erzeugerleistung, davon sollen Erdwärme (3,2 MW) und 1 ha Solarthermie – ohne Standortsicherung oder Genehmigungserklärungen – den größten Teil beitragen.
- Die Wasserstoff Potenzialbewertung als „günstig“ basiert allein auf der Nähe zum H2-Kernnetz. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist aber fraglich, ob es jemals dieses Wasserstoff Kernnetz geben wird. Das Gutachten empfiehlt zudem eine „Wasserstoffstrategie Gewerbegebiet Nord-Ost“, ohne dass Bedarf, Kosten oder Versorgungswege geklärt sind. H₂ wird als „Joker“ dargestellt, ohne die 3-4 fach höheren Kosten gegenüber Erdgas zu thematisieren. Im Szenario 2045 sind 5 GWh/Jahr als Wasserstoff für die Industrie vorgesehen, ohne dass es eine Zusage, oder wenigstens ein konkret formuliertes Interesse, von Abnehmern gäbe. Zudem gibt es weder eine Planung oder Kostenanalyse für eine H2 Infrastruktur, noch eine Kalkulation für den H2 Import. Die Realisierung des Wasserstoff-Hub Bendorf hängt ebenfalls von Fördermitteln und der Marktentwicklung (Nachfrage) ab und darf derzeit angezweifelt werden. Gescheiterte H2-Projekte wie bspw. Smart Quart in Kaiseresch ließen vor dem endgültigen Aus den Wasserstoff per LKW anliefern. Das aktuelle Potential für die Produktion von Grünen Wasserstoff ist gering – von der 10 GW angestrebten Elektrolysekapazität bis 2030 der Bundesregierung sind bislang 0,1 GW vorhanden und 0,3 GW durch Investitionsentscheidungen abgesichert (Stand 2024). Aktuell denkt man über den Import aus China nach – was wiederum ökologisch äußerst bedenklich ist – oder die Verwendung von anderen „Wasserstoff-Farben“. Dabei wird Wasserstoff bspw. aus Erdgas erzeugt. Warum sollte man so blöd sein, das Erdgasnetz umzubauen zu einem Wasserstoffnetz, dass dann mit aus Erdgas erzeugtem aber viel teureren Wasserstoff betrieben wird?
Hinzu kommen erhebliche Risikien, die sich aus der Aggressivität (Wasserstoffversprödung/Materialermüdung) und potentieller Leckage (Molekülgröße) ergeben.