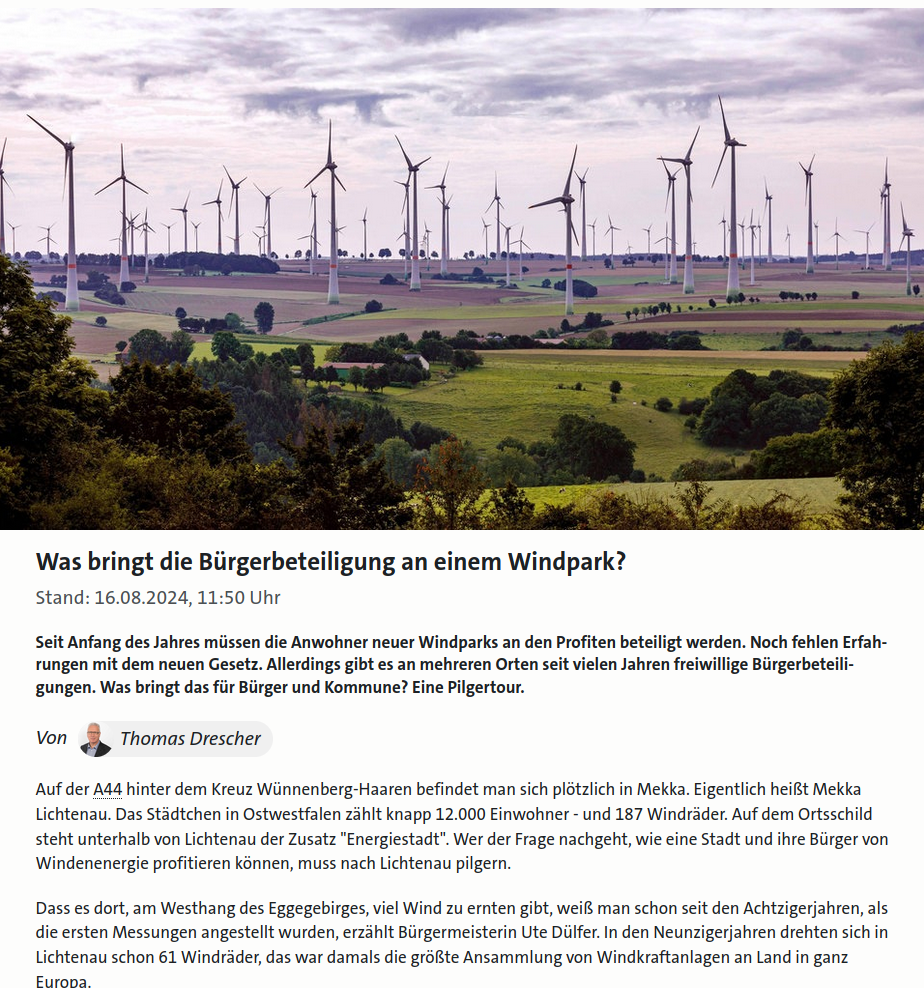
Bürgerbeteiligungen an Windparks und Freiflächenphotovoltaik-Anlagen werden oft als nachhaltige Geldanlage mit attraktiven Renditen von 4-8% beworben. Doch hinter den verlockenden Versprechen verbergen sich erhebliche Risiken, die potenzielle Anleger kennen sollten – insbesondere im Hinblick auf die Unsicherheit der EEG-Förderung.
Kurzfassung:
Man lockt die Menschen mit der Möglichkeit, einen Geldbetrag ihres Ersparten auf 20 Jahre festzulegen – Geld, dass ihnen also für andere Dinge nicht zur Verfügung steht.
Und damit können sie dann einen mickigen Anteil – Peanuts – dessen zurück „verdienen“, was ihnen in Form von Steuern und überhöhter Energiepreise an anderer Stelle abgenommen wird.
Dafür sollen sie akzeptieren, in einem Wald aus Industrieanlagen zu wohnen – mit allen negativen Folgen für Natur, Wasser und die eigene Gesundheit.
Quelle: WDR
Die Renditeversprechen sind irreführend
Beteiligungen an Windparks sollen jährliche Renditen von 4-8% erzielen, während man bei PV-Anlagen durchschnittlich mit 5-8% (Spitzenwerte bis 11%) rechnen kann (Stand 2025). Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn der Wert der Anlage nimmt ja ab: Nach 20 Jahren hat bspw. eine Windkraftanlage oft nur noch Schrottwert. Eine beworbene jährliche Ausschüttung von 8% über 20 Jahre führt dann nicht zu einer Rendite von 8%, sondern tatsächlich nur zu etwa 5%. Die notwendige Abschreibung wird in den Renditeversprechen häufig verschleiert.
Die fünf zentralen Risiken
- Totalverlustrisiko und lange Kapitalbindung: Investitionen werden für 15-25 Jahre gebunden – ein Zeitraum, in dem sich politisch und wirtschaftlich viel ändern kann. Besonders problematisch: Bei Energiegenossenschaften fehlt die strenge Prospekthaftung, die für Genussscheine und Fondsbeteiligungen gilt. Viele kleinere Genossenschaften umgehen die Prospektpflicht durch Begrenzung des Emissionsvolumens oder Beschränkung auf regionale Mitglieder. Die meisten unterliegen nicht der BaFin-Aufsicht, sondern nur der Prüfung durch genossenschaftliche Verbände.
- Das Nachrangdarlehen-Problem: Bei den meisten untersuchten Windparks decken Bürgerinvestitionen nur rund 20% der Gesamtinvestition ab. Der Großteil stammt von Banken oder institutionellen Investoren. Beim Crowdinvesting gewähren Anleger Nachrangdarlehen – im Insolvenzfall droht ein Totalverlust, da diese Gläubiger erst nach allen anderen bedient werden.
- Unkalkulierbare natürliche Risiken: Der Wind und Sonne sind unberechenbar – selbst Experten lagen in schwachen Windjahren daneben. Bei zu starkem Wind werden Anlagen wegen überlasteter Netze vom Netz genommen. Bei Photovoltaik verschärft sich das Problem: 2024 entfielen 91% der PV-Einspeisung in Phasen negativer Strompreise auf Zeiträume von mindestens drei Stunden. Bei Volleinspeisung wären bis zu 18,4% der potenziellen Erlöse nicht vergütet worden. Seit Februar 2025 gibt es bei negativen Börsenstrompreisen überhaupt keine EEG-Vergütung mehr.
- Versteckte Kosten und Steuerfallen: Unkalkulierbare Reparaturkosten sowie intransparente Provisionen, Verwaltungs- und Managementkosten sind schwer zu kontrollieren. Viele Gerichtsverfahren drehen sich um diese „Verstrickungen“. Besonders tückisch: Die steuerliche Behandlung. Als Kommanditist einer GmbH & Co. KG werden Sie Mitunternehmer und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb – nicht aus Kapitalvermögen. Dies kann zu Gewerbesteuerpflicht, höherer Besteuerung nach dem persönlichen Steuersatz statt Abgeltungssteuer und Problemen mit Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten führen.
- Der Kannibalisierungseffekt bei Solar: Je mehr Solarparks gebaut werden, desto mehr sinkt der Marktwert von Solarstrom zur Mittagszeit – die Renditen sinken strukturell. Von der 2023 neu installierten Solarstromleistung entfielen etwa 31% auf Freiflächenanlagen – ein überhitzter Markt mit massiver Konkurrenz.
- Die EEG-Unsicherheit: Die meisten Wind- und PV-Parks sind ohne staatliche Förderung nicht wirtschaftlich.
Die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen
Die erschreckende Wahrheit: Die meisten Wind- und PV-Parks sind ohne EEG-Förderung nicht wirtschaftlich. Aktuelle Börsenpreise liegen oft bei 5-10 ct/kWh, während die EEG-Vergütung für Freiflächenanlagen bei 6,79-6,80 ct/kWh liegt. Ältere Anlagen mit Vergütungen von 15-50 ct/kWh wären ohne EEG massiv defizitär.
Die Dimension der staatlichen Förderung ist gewaltig:
- Jährliche EEG-Kosten: 2024 lagen sie bei etwa 20 Milliarden Euro, für 2025 werden rund 18 Milliarden Euro erwartet
- Windkraftförderung: erhält etwa ein Viertel der Gesamtförderung, also 5-6 Milliarden Euro jährlich
- Historische Gesamtkosten: Seit 2000 sind über 300 Milliarden Euro an EEG-Differenzkosten (reinen Subventionen) aufgelaufen
- Allein die Windkraft hat in 25 Jahren schätzungsweise 75-100 Milliarden Euro Subventionen erhalten
Besonders problematisch: Schwachwindstandorte
In Süddeutschland werden besonders windschwache Standorte noch stärker subventioniert. An einem Schwachwindstandort mit 60% Referenzertrag erhält der Betreiber 42% mehr Vergütung pro Kilowattstunde. Bei einem Höchstwert von 7,35 Cent/kWh können dort über 10 Cent/kWh fließen – dennoch bleibt die Wirtschaftlichkeit fraglich.
Gibt es Garantien für die EEG-Förderung?
Zwar genießen Betreiber bestehender Anlagen verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz für die 20-jährige Vergütung. Doch das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt: Dieser Schutz „schließt nicht jegliche Randkorrektur der Gewährungsbedingungen aus, sofern sie sich auf ein berechtigtes öffentliches Interesse stützen kann.“
Die allgemeine Erwartung, das geltende Recht werde unverändert bleiben, genießt keinen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz.
Die politischen Risiken
- Politischer Kurswechsel: Das politische Risiko ist enorm. Bundesministerin Katherina Reiche kündigte bereits an, die fixe Einspeisevergütung für neue Photovoltaik-Anlagen abschaffen zu wollen. Ein Regierungswechsel zu einer „Anti-EEG“-Koalition könnte das System radikal ändern.
- Haushaltsnotlage: Bei massiven Staatsausgaben oder einer Haushaltskrise könnten EEG-Subventionen gekürzt oder gestrichen werden. Die Investition basiert auf staatlicher Zahlungswilligkeit UND -fähigkeit – beides ist bei Kriegsfall, Staatspleite, Energiekrise oder politischem Kurswechsel massiv gefährdet.
- Kriegsfall und Notstand: Die Notstandsgesetze von 1968 ermöglichen es der Regierung, im Verteidigungsfall Grundrechte einzuschränken und Gesetze per „Gemeinsamem Ausschuss“ ohne normale parlamentarische Verfahren zu ändern.
- EEG-Zahlungen könnten als „nicht systemrelevant“ ausgesetzt werden
- Im Kriegsfall hätte die Versorgungssicherheit absoluten Vorrang
- Bei massiven Kriegskosten könnten EEG-Subventionen als „verzichtbar“ gestrichen werden
- Eine rückwirkende Änderung wurde von Gerichten bereits für zulässig erachtet
Fazit: Eine kritische Einschätzung
Massive Schwachpunkte der Bürgerbeteiligungen:
- 20 Jahre sind politisch eine Ewigkeit – was heute garantiert scheint, kann morgen Geschichte sein
- Kriegsfall/Notstand eliminiert praktisch jeden Schutz – im Ernstfall würden EEG-Zahlungen sehr wahrscheinlich ausgesetzt
- Die Abhängigkeit von über 300 Milliarden Euro Subventionen seit 2000 zeigt: Diese Investitionen sind ohne staatliche Unterstützung nicht tragfähig
- Für Photovoltaik gilt seit Februar 2025: Bei negativen Strompreisen keine Vergütung mehr – ein fundamentaler Einschnitt
Wer sollte trotzdem investieren?
Nur wer sich dieser erheblichen Risiken bewusst ist und bereit ist:
- Kapital für 15-25 Jahre zu binden
- Das Totalverlustrisiko zu tragen
- Auf die Zahlungswilligkeit und -fähigkeit des Staates zu vertrauen
- Mit deutlich niedrigeren Renditen als versprochen zu rechnen
Für Anleger, die auf Sicherheit und Flexibilität angewiesen sind – etwa für die Altersvorsorge – sind diese Beteiligungen nicht geeignet. Die beworbenen Renditen stehen in keinem angemessenen Verhältnis zu den vielfältigen und schwer kalkulierbaren Risiken.